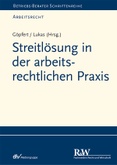- Vorwort
- Bearbeiterverzeichnis
- Inhaltsverzeichnis
- A. Alternativen und Rechtsgrundlagen der Streitlösung im Arbeitsrecht
- I. Die Parteien Arbeitgeber – Arbeitnehmer
- 1. Der klassische Weg – ein Gerichtsverfahren
- a) Die erste „offizielle“ Chance zur Einigung: Der Gütetermin
- b) Das Güterichterverfahren als „Seitensprung“
- c) Streitbeilegung nach einem Urteil
- 2. Alternative Wege
- a) Die außergerichtliche Mediation – es ist nie zu spät
- b) Außergerichtliche Streitschlichtung aufgrund von Kollektivvereinbarungen
- c) Außergerichtliche Schlichtung aufgrund von Individualvereinbarungen
- II. Die Parteien Arbeitgeber – Betriebsrat
- 1. Das gerichtliche Beschlussverfahren
- 2. Die Einigungsstelle
- 3. Alternative Wege
- a) Freiwillige Einigungsstelle/andere Schlichtungsverfahren
- b) Moderierte Verhandlungen
- c) Mediation zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
- III. Die Parteien Arbeitgeber – Gewerkschaft
- 1. Das arbeitsgerichtliche Verfahren
- 2. Die Tarifschlichtung
- B. Die Praxis der arbeitsrechtlichen Streitlösung
- I. Die Grundlage jeder Lösung: Psychologie der Verhandlungsführung
- 1. Die Fairness-Falle
- 2. Systemzustand 1: Rein in die Fairness-Falle
- 3. Systemzustand 2: Raus aus der Fairness-Falle durch Mediation
- a) Worum geht es?
- b) Die einzelnen Phasen
- aa) Die Rahmenbedingungen
- bb) Einführung durch den Moderator
- cc) Sammeln der Themen/Ordnen der Themen
- dd) Klären der Interessen
- ee) Ideensuche, Lösungsoptionen
- ff) Auswahl des Denkbaren
- gg) Vereinbarungen festhalten
- 4. Zusammenfassung
- II. Der „Klassiker“: Gütetermin im Urteils- und Beschlussverfahren
- 1. Gesetzliche Regelung und Zweck der Güteverhandlung
- 2. Erforderlichkeit der Güteverhandlung
- a) Urteilsverfahren
- b) Beschlussverfahren
- 3. Güteverhandlung als separater Termin
- 4. Vorbereitung der Güteverhandlung
- a) Gericht
- aa) Terminierung
- bb) Persönliches Erscheinen
- cc) Frist zur Erwiderung
- dd) Inhaltliche Vorbereitung
- b) Parteien, Beteiligte und ihre Bevollmächtigten
- aa) Terminierung
- bb) Terminswahrnehmung
- cc) Schriftsätzliche Erwiderung
- dd) Inhaltliche Vorbereitung
- ee) Außergerichtliche Vergleichsverhandlungen
- 5. Durchführung der Güteverhandlung
- a) Keine Antragstellung
- b) Sachverhaltsaufklärung, Erörterung und Lösungsmöglichkeiten
- aa) Erörterung
- bb) Sachverhaltsaufklärung
- cc) Gütliche Einigung
- dd) Andere Lösungsmöglichkeiten
- ee) Ergebnis der Güteverhandlung
- 6. Säumnis einer Partei
- 7. Gütetermin und Prozesskostenhilfe
- 8. Fazit
- III. Die gerichtliche Alternative: Das Verfahren vor dem Güterichter und Alternative Mediation
- 1. In welchen Konfliktsituationen welches Verfahren wählen?
- a) Grundkonstellation: Güteverfahren/Gütetermin
- b) Alternative Lösungen?
- aa) Güterichterverfahren
- bb) Mediation
- 2. Fazit: Maßgebliche Unterschiede zwischen Güterichter und Mediation
- IV. Einsatzmöglichkeiten der Mediation im Arbeitsrecht
- 1. Mediationstauglichkeit von arbeitsrechtlichen Konflikten
- 2. Mediation zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer
- a) Mediation im bestehenden Arbeitsverhältnis
- aa) Reorganisation/Fusion/Umstrukturierung
- bb) Streit um Vergütungsansprüche
- cc) Spannungsfeld Betriebsratstätigkeit und Arbeitsleistung
- dd) Gehaltsanpassung bei Betriebsräten
- b) Mediation während laufendem gerichtlichen Verfahren
- c) Mediation bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses
- aa) Mediation vor Ausspruch einer Kündigung
- bb) Mediation während des Kündigungsschutzprozesses
- 3. Mediation zwischen Arbeitnehmern
- 4. Mediation zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
- a) Mediation zur Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Arbeitgeber und Betriebsrat
- b) Mediation in Mitbestimmungsangelegenheiten
- 5. Mediation zwischen Betriebsräten
- 6. Mediation zwischen Arbeitgeber und Gewerkschaften
- 7. Fazit
- V. Der kollektivrechtliche „Klassiker“: Einvernehmliche Errichtung und Anrufung einer Einigungsstelle und Einsetzungsverfahren
- 1. Bedarf für die Errichtung einer Einigungsstelle
- a) Errichtungsgründe
- aa) Erzwingbares Verfahren
- bb) Freiwilliges Verfahren
- cc) Ständige Einigungsstelle
- 2. Die Anrufung der Einigungsstelle
- 3. Die Errichtung der Einigungsstelle
- a) Die gerichtliche Errichtung einer Einigungsstelle
- aa) Antrag
- bb) Zuständigkeitsprüfung
- cc) Beschleunigtes Verfahren
- dd) Auswahl des Vorsitzenden
- ee) Anzahl der Beisitzer
- ff) Konsequenzen
- b) Die einvernehmliche Errichtung der Einigungsstelle
- aa) Vorteile der einvernehmlichen Errichtung
- bb) Verhandlungspunkte
- VI. Der „Good and Worst Case“ in einer Einigungsstelle
- 1. Der „Good Case“: Die Spruchvermeidung
- a) Aufgabe
- b) Zeitpunkt
- c) Ladung
- d) Arbeitsumgebung
- e) Inhaltliche Vorbereitung
- f) Beisitzer
- g) Haltung
- h) Vorsitzender
- i) Gerichtliche Bestellung
- j) Ablauf
- k) Interessenklärung
- l) Pendeldiplomatie (shutteln)
- m) Lösungsfindung
- n) Faktor Zeit
- 2. Der „Worst Case“: Die „schwierige“ Einigungsstelle
- a) Wann ist eine Einigungsstelle „schwierig“?
- b) Der Weg in eine „schwierige“ Einigungsstelle
- c) „Schwierige“ Zuständigkeitsfragen nicht aufschieben
- d) Entscheidungserheblichkeit, Entscheidungszuständigkeit und Spruchkompetenz
- e) Wenn es zuletzt zum „Schwur“ kommt: Der Spruch der Einigungsstelle
- VII. Neue Ansätze: Moderierte Verhandlungen bei Betriebsänderungen
- 1. Bisherige Praxisansätze
- a) „Vorfeld“-Moderation zur Vermeidung einer formalen Einigungsstelle
- b) „Mehr-Parteien“-Moderation bei komplexen Gremien-Situationen
- c) Moderation im Umfeld eines möglichen Tarifsozialplans
- d) Moderation bei komplexer Finanzierungs- und Eigentümer-Struktur
- 2. Indikation für eine Moderation
- a) Wunsch aller Parteien nach einem Ergebnis auf freiwilliger Basis
- b) Wunsch nach Informalität und Vertraulichkeit
- c) Wunsch nach Prozess-Transparenz („ordnende Hand“)
- d) Möglichkeit der Formalisierung von Ergebnissen
- 3. Rolle und Auswahl des Moderators
- a) Konsensfähig und neutral
- b) Profi ohne eigene Ambitionen
- c) Autorität durch bloße Präsenz im Prozess
- d) Ordnender Rechtsrat, ohne sich persönlich festzulegen
- e) Englischkenntnisse
- f) Autorität gegenüber Dritten
- g) Kein „Makler“, sondern nur Moderator
- h) Verschwiegenheit
- i) Bereitschaft zur formalen Lösung?
- j) Bereitschaft zur „Niederlegung“
- 4. Moderationsvereinbarung
- a) Bestimmung der Parteien
- b) Bestimmung des Gegenstands
- c) Einvernehmliche Bitte um Moderation
- d) Beschreibung der wesentlichen Aufgaben im Prozess
- e) Niederlegungsrecht, Haftungsausschluss
- f) Vertraulichkeit und Entbindungsregelung
- g) Kostentragung, Aufwandsentschädigung, Vorschuss
- h) Laufzeit und Beendigung
- i) Überleitung in eine Einigungsstelle?
- 5. Vorbereitung und Ablauf der Moderation
- a) Vorbereitung
- b) Typischer Ablauf
- 6. Überleitung in ein Einigungsstellenverfahren?
- a) „Moderationswirkungen“ auf eine Einigungsstelle
- b) Moderationswirkungen im Einigungsstelleneinsetzungsverfahren
- 7. Fazit
- VIII. Tarifverträge als Mittel der betrieblichen Konfliktlösung
- 1. Warum Tarifverträge, es gibt doch Betriebsvereinbarungen?
- a) Der Betriebsrat als Teil des Unternehmens
- b) Regelungssperre für tarifübliche Regelungen
- c) Gestaltungsoptionen durch Tarifvertrag
- 2. Wann sollten tarifliche Lösungen mitgedacht werden?
- a) Mögliche Felder für tarifliche Regelungen
- b) Die zwei Perspektiven der Umstrukturierung
- aa) Umstrukturierungsmaßnahmen verunsichern
- bb) Den psychologischen Vertrag7 mitdenken
- cc) Die Absicherung ausscheidender Beschäftigter
- dd) Die Zukunftsperspektive unterstreichen
- ee) Über die Grenzen der Betriebsverfassung hinausdenken
- c) Entgeltgleichheit von Frauen und Männern
- d) Arbeits- und Gesundheitsschutz
- e) Die Qualifizierung der Qualifizierten
- f) Tarifverhandlungen sind stark lösungsorientiert
- 3. Abschließende Hinweise
- a) Vorteil durch Tarifvertrag
- b) Tarifschlichtung und moderierte Gespräche
- c) Aus Erfahrung: Tarifvertrag
- d) Formelles
- Literaturverzeichnis
- Sachregister
- Sachregister A
- Sachregister B
- Sachregister C
- Sachregister D
- Sachregister E
- Sachregister F
- Sachregister G
- Sachregister H
- Sachregister I
- Sachregister K
- Sachregister M
- Sachregister O
- Sachregister P
- Sachregister Q
- Sachregister R
- Sachregister S
- Sachregister T
- Sachregister U
- Sachregister V
- Sachregister Z